Gepostet 24.02.2025, Romy Niederberger
Der Podcast «Lehrreich» unterstützt Jugendliche bei der Berufswahl und gibt spannende Einblicke in verschiedene Lehrberufe. Eine Mediamatik-Lernende im ersten Lehrjahr hat sich den Podcast genauer angehört. Wie gut erfüllt «Lehrreich» seinen Anspruch?
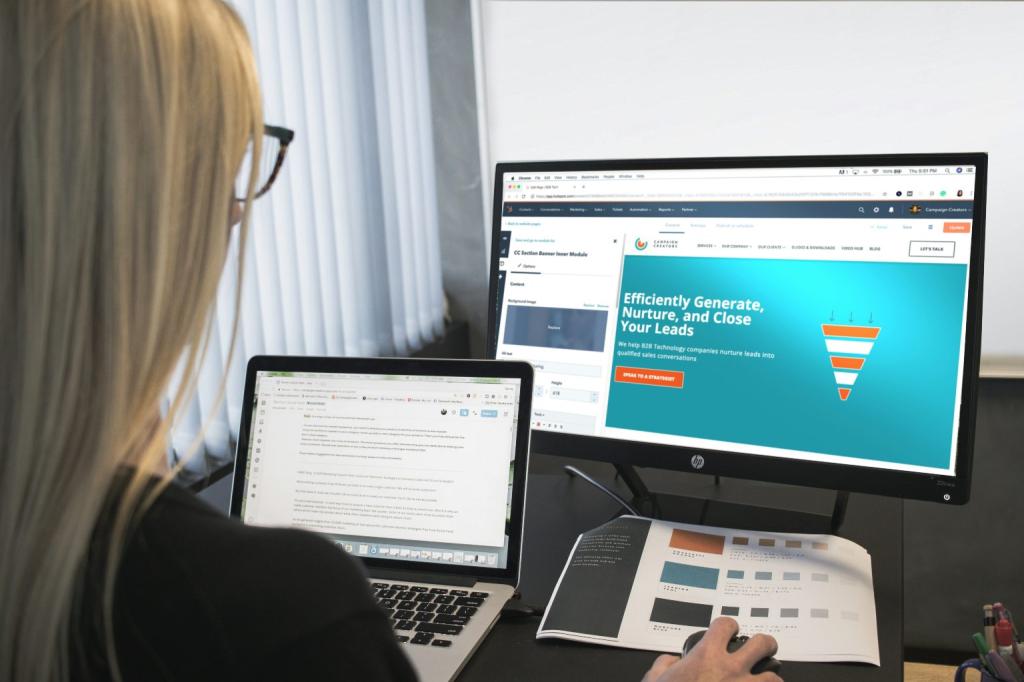
Mediamatik-Lernende bei der Firma Roche in Rotkreuz beleuchten in jeder 20-minütigen Lehrreich-Podcast-Folge ein Thema rund um die Berufsausbildung – von verschiedenen Lehrberufen bis hin zu praktischen Tipps für den Lehrstart. Der Podcast richtet sich an Jugendliche, die vor der Berufswahl stehen. Auch das Berufsberatungszentrum (BIZ) oder Themen ausserhalb der Mediamatik finden ihren Platz.
Romy Niederberger, Lernende Mediamatikerin im 1. Lehrjahr, hat sich die beiden Folgen «#12 Mediamatiktalk» und «#16 Einblicke ins erste Lehrjahr als Mediamatiker:in» angehört und nimmt Stellung zu Aussagen sowie zu Inhalten, die im Podcast behandelt werden.
Sie beurteilt, wie gut die Podcast-Folgen den Alltag von Mediamatik-Lernenden widerspiegeln und welche Tipps für Berufseinsteiger besonders nützlich sind. Romy erwähnt auch, welche Themen ihrer Meinung nach noch vertieft werden könnten, um den Podcast für zukünftige Lernende noch wertvoller zu machen.
Vielseitiger Beruf
Sarah ist auf den Beruf der Mediamatikerin aufmerksam geworden, als ihre Lehrerin auf sie zukam und ihr eine Schnupperlehre vorschlug. Sarah vermutet, dass die Lehrperson auf diesen Beruf gekommen ist, weil Sarah damals in der Schule sehr schöne Präsentationen und Plakate gestaltet hat. Das heisst aber nicht, dass nur Menschen, die gerne gestalten, diesen Beruf ausüben können. Die Lehre zum/r Mediamatiker/in umfasst nämlich 3 verschiedene Vertiefungsrichtungen und je nach Lehrbetrieb liegt der Schwerpunkt auf einem der folgenden Bereiche: Informatik, Multimedia oder Projektmanagement. Bei Sarah und Romy liegt der Schwerpunkt auf Multimedia und Gestaltung.
Man könnte meinen, dass Mediamatiker/innen immer kreativ und gestalterisch arbeiten, aber wie schon erwähnt, kommt es auf den Schwerpunkt an. Damit meint Romy, dass der Beruf auch etwas für Menschen ist, die sich für Informatik (Software/digitale Technologien) begeistern können oder sich für betriebswirtschaftliche Abläufe interessieren.

Sarah findet, dass man als Mediamatiker/in unbedingt offen und kreativ sein sollte. Man sollte auch auf Menschen zugehen können und teamfähig sein. Sie ergänzt, dass logisches/technisches Denken nicht zu den Anforderungen gehört. Es ist aber so, dass logisches Denken hilft, Webprojekte, Datenverarbeitung oder Abläufe effizient zu gestalten. Technisches Denken hingegen ist wichtig für IT, Mediengestaltung und digitale Tools.
Zu einem späteren Zeitpunkt spricht Sarah das Durchhaltevermögen an. Sie sagt, dass wenn man mit einem Projekt fertig ist und es den Verantwortlichen zeigt, es doch noch nicht fertig ist, da es immer Verbesserungsvorschläge gibt, besonders während der Lehrzeit. (Sie spricht von einem Animationsvideo, welches sie erstellt hat.) Deswegen muss man gut durchhalten können, denn es kommt oft vor, dass man Arbeiten korrigieren oder sogar nochmals neu damit anfangen muss.
Man sollte sich aber bewusst sein, dass dies völlig normal ist, da man sich noch in der Lernphase befindet, egal in welchem Lehrjahr man ist. Besonders am Anfang hat man das Wissen noch nicht und durch das Feedback kann man viel Neues für das nächste Mal mitnehmen.
Programmieren
Remo und Sarah unterhalten sich über die Module der Berufsschule zum Thema Programmieren. Remo sagt, dass in der Schule viel über das Programmieren behandelt wird, was Romy bestätigen kann. Gerade bei Mediamatik-Lernenden im Bereich Marketing/Gestaltung oder Projektmanagement steht das Programmieren im Betrieb nicht im Mittelpunkt und sie haben daher im Betrieb auch weniger mit Codieren zu tun.
Da es aber auch Teil der Lehre als Mediamatiker/in ist, muss ein Grundwissen auf jeden Fall vorhanden sein. Lernende sollten sich aber bewusst sein, dass sie, wenn sie in einer Firma arbeiten, in der das Programmieren den Hauptteil ihrer Arbeit ausmacht, in diesen Modulen einen «Vorteil» in der Schule haben. Es ist also normal, dass in der Berufsschule Themen behandelt werden, mit denen man im Betrieb fast nie in Berührung kommt und dass die Lernenden in der Klasse ihre Stärken in unterschiedlichen Bereichen haben, da der Beruf des/der Mediamatikers/Mediamatikerin sehr vielfältig ist.
Perspektiven
Die Perspektiven als Mediamatiker/in sind laut Sarah so vielfältig wie der Beruf selbst: Man kann sich nach der Lehre in den Bereichen Marketing, Video, Animation, Radio oder Fotografie weiterentwickeln. Sarah geht aber nur auf die gestalterischen Weiterbildungsmöglichkeiten ein. Natürlich kann man sich auch in vielen weiteren Bereichen wie Projektmanagement oder Informatik weiterbilden.
Überbetriebliche Kurse
Remo erklärt, dass man neben der Berufsschule und der Arbeit die üK besuchen muss. In diesen üK werden Mediamatik-Kompetenzen vermittelt. Sarah erklärt, dass man innerhalb von 5 Tagen ein Thema vertieft und es meistens Themen sind, die man bereits in der Berufsschule hatte oder auf die man im Betrieb gestossen ist. Diese Tage sind sehr kopflastig und es braucht viel Energie, da man 5 Tage intensiv an dem Projekt arbeitet.
Es wäre interessant gewesen zu wissen, wo die üK stattfinden und ob das Ganze bewertet wird. Das wurde nicht erwähnt und würde helfen, sich ein Bild zu machen. (In der Schule selbst, ausserhalb, Orte, ...)
«Als ich zum ersten Mal von überbetrieblichen Kursen gehört habe, dachte ich, dass man ein paar Tage ausserhalb der Berufsschule/Betrieb lernt und dort auch übernachtet.»
Romy Niederberger, damals 11 Jahre alt
Erklärung: Die überbetrieblichen Kurse (üK) vermitteln wichtige Grundfertigkeiten und ergänzen die Ausbildung in Betrieb und Berufsschule. Sie sind notwendig, wenn bestimmte Fertigkeiten nicht direkt im Betrieb erlernt werden können. Die Kosten trägt der Lehrbetrieb.
Fachbegriffe
Zu Beginn wird die interviewte Person Chiara gefragt, an welches Projekt sie sich gerne erinnert. Sie verwendet unter anderem Fachbegriffe wie «Icons» oder «Brandings», die genauer erklärt werden sollten, damit Schülerinnen und Schüler dem Podcast besser folgen können.
Erklärung: Chiara spricht im Wesentlichen über Grafiken oder Symbole, die sie zu Beginn ihrer Lehrzeit modernisiert hat, um sie auf Websites oder Flyern zu verwenden.
Basislehrjahr
Auf die Frage, ob es anfangs Herausforderungen gab, spricht Chiara das «Basislehrjahr» an. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer wäre eine Erklärung hilfreich gewesen, da nicht alle wissen, was es ist und wie es abläuft. Zudem gibt es das Basislehrjahr nicht in allen Betrieben.
«Meine Freundin (Informatikerin im 1. Lehrjahr) hat mir zu Beginn der Lehre erzählt, dass sie neben der Berufsschule auch das Basislehrjahr absolviert. Ich konnte mir zuerst nichts darunter vorstellen.Nachdem sie es mir genauer erklärt hat, habe ich das Ganze schon besser verstanden, aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum manche Betriebe es anbieten und andere nicht.»
Romy Niederberger
Erklärung: Das Basislehrjahr ist eine besondere Form des ersten Jahres einer beruflichen Grundbildung, in der die Lernenden zentrale berufliche Grundfertigkeiten in einem Ausbildungszentrum erlernen. Das Basislehrjahr wird vor allem in Informatikberufen angeboten. Ziel ist es, die Lehrbetriebe zu entlasten, indem dort die Grundfertigkeiten vermittelt werden, bevor die Ausbildung direkt im Betrieb fortgesetzt wird. Die Lernenden haben zu Beginn des Basislehrjahres bereits einen gültigen Lehrvertrag für die gesamte Ausbildungsdauer. Die Kosten für das Basislehrjahr trägt in der Regel der Lehrbetrieb.
Lehrbeginn
Chiara beschreibt, wie sie sich anfangs zurechtfand und wie sie sich fühlte. Remo ergänzt, dass es normal ist, dass man sich nicht gleich mit allen Tools und Programmen auskennt und dass es mit der Zeit immer besser funktioniert. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn schliesslich ist man eine lernende Person, die normalerweise noch keine Vorkenntnisse hat und sich erst mit den Tools auseinandersetzen muss.
Berufsschule & Fächer
Es wird erwähnt, dass Mediamatik-Lernende ohne BMS an zwei Tagen pro Woche die Berufsschule besuchen. Auch die regelmässigen Prüfungen kommen zur Sprache – es gibt fast keine Woche, in der man keine Prüfung hat. Dies ist wichtig zu wissen, da es für einige Schülerinnen und Schüler eine Herausforderung sein kann, sich darauf einzustellen. Sobald sie in der Arbeitswelt ankommen, müssen sie ihre Lernzeit daher gut einteilen.
Unterricht
Einige Lehrpersonen stellen den Lernenden in der Berufsschule das Arbeitsmaterial zur Verfügung und lassen sie selbstständig arbeiten. Diese Methode ist in Schulen noch eher unüblich, weshalb es für zukünftige Mediamatiker/innen herausfordernd sein kann, sich den Stoff eigenständig anzueignen.
Chiara bevorzugt eine andere Art des Unterrichts – sie lernt besser, wenn die Lehrperson den Stoff an der Tafel erklärt. Romy stimmt ihr vollkommen zu. Da der Unterricht von Lehrperson zu Lehrperson unterschiedlich gestaltet wird, gewöhnt man sich mit der Zeit an verschiedene Methoden. Falls sich diese jedoch negativ auf die Noten auswirken, sollte man das Gespräch mit der Lehrkraft suchen.
Chiara spricht auch von «Modulen». Hier ist es wichtig zu wissen, dass nicht jeder Beruf Module in der Berufsschule hat. Vor allem die ICT-Berufe behandeln in der Berufsschule bestimmte Module. Die Module können sich in jedem Lehrjahr oder sogar semesterweise ändern. Jedes Modul enthält eine genaue Beschreibung der zu erwerbenden Kompetenzen.
Selbstständigkeit
Von Mediamatiker/innen wird viel Selbständigkeit verlangt. Man steht am Anfang des Berufslebens und trägt viel Verantwortung. Chiara ergänzt auch, dass man davon sehr profitiert, da man diese Fähigkeit auch in Zukunft einsetzen kann. Auch im Betrieb arbeitet man die meiste Zeit selbstständig an seinem Platz und erledigt seine Aufgaben. Bei Fragen kann man aber immer auf den Berufsbildner/die Berufsbildnerin zugehen.
Romy ist der Meinung, dass die Idee, einen Podcast zu machen, in dem Mediamatik-Lernende über ihre Lehre und das Berufsleben sprechen, sehr originell, modern und interessant ist. Für die Schülerinnen und Schüler ist es hilfreich, die Perspektive der Lernenden zu hören und sich im Voraus über die Lehre zu informieren.
Gerade wenn die Lernenden keine älteren Geschwister haben, die eine Lehre absolvieren oder bereits abgeschlossen haben, ist es hilfreich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die Unterschiede zwischen Schulzeit und Berufsleben zu erkennen.
Die Fragen, die den einzelnen interviewten Personen gestellt werden, sind sehr eindrücklich. Es werden eigene Meinungen eingebracht und Beispiele genannt. Auch ist es spannend zu hören, an welchen Projekten Mediamatiker/innen unter anderem arbeiten.
Daher ist es wichtig, bei der Lehrstellensuche über die Schwerpunkte des jeweiligen Betriebes zu informieren.